
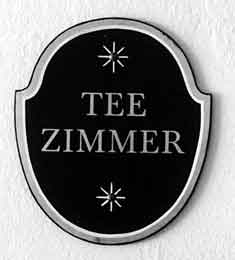 Freudenstadt
a spa town in the Black Forest was destroyed at the end of World War
II by the French army. After the war the citizens decided to rebuild
their town as quick as possible because tourism was the main business
for Freudenstadt. The architect Ludwig Schweizer was commissioned
for the masterplan and Freudenstadt was rebuilt in the romantic Heimatstil".
The first tourists came back to the new Freudenstadt in 1951. Remarkable
is the spa house. Here the 50s resisted all attacks of renovations.
Forgotten pieces of furniture are standing on the floors. Colorful,
abstract paintings of the post-war era are hanging on the walls. You
can admire the huge candelabrums in the main hall, constructed with
the limited post-war materials of the German 50s. Here the rubber
plants survived and could grow in peace.
Freudenstadt
a spa town in the Black Forest was destroyed at the end of World War
II by the French army. After the war the citizens decided to rebuild
their town as quick as possible because tourism was the main business
for Freudenstadt. The architect Ludwig Schweizer was commissioned
for the masterplan and Freudenstadt was rebuilt in the romantic Heimatstil".
The first tourists came back to the new Freudenstadt in 1951. Remarkable
is the spa house. Here the 50s resisted all attacks of renovations.
Forgotten pieces of furniture are standing on the floors. Colorful,
abstract paintings of the post-war era are hanging on the walls. You
can admire the huge candelabrums in the main hall, constructed with
the limited post-war materials of the German 50s. Here the rubber
plants survived and could grow in peace.
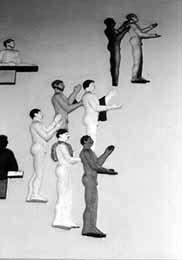 Zehn
Tage vor Kriegsende 1945 brannte Freudenstadt nach französischem
Artilleriebeschuß fast vollständig ab. Die Bürger
der Schwarzwaldstadt wollten ihren Kurort so schnell wie möglich
wiedererrichten, da der Tourismus ihre Haupteinnahmequelle war. Was
sie aber nicht wollten, war eine Utopie, so wie sie Le Corbusier beispielsweise
für den Wiederaufbau der Stadt Saint Dié in den Vogesen
vorgeschlagen hatte. Der Architekt visionierte den zerstörten
französischen Ort durch mehrere Hochhäuser zu ersetzen,
durchgeführt wurde der Plan jedoch nie. Für den Wiederaufbau
Freudenstadts war Ludwig Schweizer verantwortlich, ein Stuttgarter
Baumeister - er hatte die Bürgerschaft nach einem langjährigen
Planungsweg schließlich am meisten überzeugt mit seinen
Vorschlägen. Er errichtete auf dem ehemaligen Renaissancegrundriß
der Planstadt, einem Mühlebrett, die neue Stadt im Heimatstil
der Stuttgarter Schule. Der Wiederaufbau war 1951 so weit fortgeschritten,
daß der Tourismus beginnen konnte und die Menschen aus ihren
zerstörten Städten wieder in die neue Stadt von gestern
kamen. Man traf sich im Kurhaus, hörte Konzerte und diskutierte
über die neue Kunst an den Wänden. Der heutige Besucher
steht nach 50 Jahren in der Halle des Kurhauses und wundert sich darüber,
wie das gesamte Interieur die Renovierungswut der 70iger Jahre und
die Phase postmoderner Erneuerung überlebt hat - sofort unter
Denkmalschutz stellen! Kein Halogenstrahler stört die Betrachtung
der Bilder, die von dem rötlichen Glühbirnenlicht der Blechsonnenlampen
in den Gängen dürftig beschienen werden. Der große
Kandelaber in der hohen Halle ist mit den einfachen Mitteln, die nach
dem Krieg zur Verfügung standen, in einem elegant klassichen
Stil entworfen worden. Kommoden, nach den Entwürfen des Architekten
Schweizer gebaut, möblieren die Flure. Schilder, welche die Säle
bezeichnen, wurden liebevoll von Hand gemalt. Die gesamte Kunstsammlung
des Hauses stammt aus den 50iger und 60iger Jahren und repräsentiert,
was zu dieser Zeit im süddeutschen Raum Rang und Namen hatte,
wie zum Beispiel ein großer Holzschnitt von Hap Grieshaber oder
Ungegenständliches von Ackermann. Vieles an den Wänden drückt
die damalige Sehnsucht nach dem Süden aus und äußert
sich in bunten Farben. Selbst die großen Gummibäume scheinen
hier überlebt zu haben und konnten in Ruhe weiterwachsen.
Zehn
Tage vor Kriegsende 1945 brannte Freudenstadt nach französischem
Artilleriebeschuß fast vollständig ab. Die Bürger
der Schwarzwaldstadt wollten ihren Kurort so schnell wie möglich
wiedererrichten, da der Tourismus ihre Haupteinnahmequelle war. Was
sie aber nicht wollten, war eine Utopie, so wie sie Le Corbusier beispielsweise
für den Wiederaufbau der Stadt Saint Dié in den Vogesen
vorgeschlagen hatte. Der Architekt visionierte den zerstörten
französischen Ort durch mehrere Hochhäuser zu ersetzen,
durchgeführt wurde der Plan jedoch nie. Für den Wiederaufbau
Freudenstadts war Ludwig Schweizer verantwortlich, ein Stuttgarter
Baumeister - er hatte die Bürgerschaft nach einem langjährigen
Planungsweg schließlich am meisten überzeugt mit seinen
Vorschlägen. Er errichtete auf dem ehemaligen Renaissancegrundriß
der Planstadt, einem Mühlebrett, die neue Stadt im Heimatstil
der Stuttgarter Schule. Der Wiederaufbau war 1951 so weit fortgeschritten,
daß der Tourismus beginnen konnte und die Menschen aus ihren
zerstörten Städten wieder in die neue Stadt von gestern
kamen. Man traf sich im Kurhaus, hörte Konzerte und diskutierte
über die neue Kunst an den Wänden. Der heutige Besucher
steht nach 50 Jahren in der Halle des Kurhauses und wundert sich darüber,
wie das gesamte Interieur die Renovierungswut der 70iger Jahre und
die Phase postmoderner Erneuerung überlebt hat - sofort unter
Denkmalschutz stellen! Kein Halogenstrahler stört die Betrachtung
der Bilder, die von dem rötlichen Glühbirnenlicht der Blechsonnenlampen
in den Gängen dürftig beschienen werden. Der große
Kandelaber in der hohen Halle ist mit den einfachen Mitteln, die nach
dem Krieg zur Verfügung standen, in einem elegant klassichen
Stil entworfen worden. Kommoden, nach den Entwürfen des Architekten
Schweizer gebaut, möblieren die Flure. Schilder, welche die Säle
bezeichnen, wurden liebevoll von Hand gemalt. Die gesamte Kunstsammlung
des Hauses stammt aus den 50iger und 60iger Jahren und repräsentiert,
was zu dieser Zeit im süddeutschen Raum Rang und Namen hatte,
wie zum Beispiel ein großer Holzschnitt von Hap Grieshaber oder
Ungegenständliches von Ackermann. Vieles an den Wänden drückt
die damalige Sehnsucht nach dem Süden aus und äußert
sich in bunten Farben. Selbst die großen Gummibäume scheinen
hier überlebt zu haben und konnten in Ruhe weiterwachsen.