
"Besuchen Sie uns und spüren Sie etwas von der Erregung im Umfeld von Entdeckungen an der Grenze unseres Wissens. Machen Sie einen Ausflug zurück zum Urknall, mit dem die Zeit ihren Anfang nahm !"
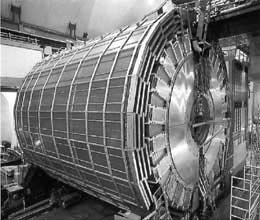 Where
you can participate in one of mankinds greatest adventures Guided
tours in and around CERN Science as an attraction, the scientist as
a pioneer fighting his way through the jungel of unknown spaces. We
take part in "The Adventure of Science" ( the title of a German TV-series),
being guided through the panoptica of microscopic worlds, stunned
by the apparently endless variety and richness of physical microstructures
and the empty space connecting them. It is about truth and Beauty,
strange and Charm, UP and DOWN – there are the terms for the smallest
particles of matter whose existence has ever been proved. We are at
CERN, the Europeen Laboratory for Particle Physics, one of the world's
largest scientific laboratories. It stretches out on both sides of
the French-Swiss border, just west of the city of Geneva. There the
scientists deal with frontline research, pure science - particle physics
- probing the inner most constituents of matter to find out how our
world and the whole of the Universe works. To achieve this, they use
the world's largest scientific machine - the LEP electron-positron
collider. To protect the highly sensitive experiments against influence
by cosmic rays, almost the whole technical site (colliderrings, detectors,
laboratories) is installed under ground, varying in depth from 50
to 150 meters. There, beams of electrons and their counterpart, positrons,
are whirled round in a 27 kilometers underground ring to within a
hair's breadth of the speed of light and smashed together. Four mighty
detectors, each as big as a four-storey building, are spaced round
the ring to intercept, record and analyse the emerging fragments of
matter. Under the skilled guidance of a physicist ( as promised in
the CERN advertisement), the basic terms and processes become clearer
throughout the tour. After descending with the elevator down to a
hundred meters, you are fascinated by the gigantic detectors and after
glancing into the tunnel where the engineers installed the longest
vaccum on earth in an unspectecular tube, in which they speed up particles
to nearly the speed of light and and and.. - you can no longer deny
the futuristic charm and hold back your admiration for such exceptional
technology. Neither Disney nor Spielberg could have thought of a better
background for an enterprise with the title 'frontline research'.
But however futuristic and 'science fiction' the surrounding may appear,
working with these tools is a lot more prosaic. The visually striking
images of explosions, which are a result of the collisions inside
the detectors, aren't so much a reason to dream and speculate as to
work hard and long on counting, measuring and endless calculations.
That is part of the job of the more than 3000 employees of CERN. Moreover,
teams of scientists, and universities from all over the world take
part in the numerous experiments carried out with the LEP. To avoid
making the results subject to national or institutional interests,
they are discussed in open meetings and published in various media.
CERNs aim is pure science with no immediate technological or commercial
objectives. But the actual reason to come to Geneva are not only the
promises of the advertisement-brochure. In fact, this is something
you discover later on in the institutes' own souvenir shop, between
videos, buttons, baseball caps, t-shirts, cups, books and the recording
of the all-women-band "Les Horrible Cernettes" ( who definetly keep
their promise). There you can also find an aerial view of the region
between Lake Geneva and the French Jura mountains, with the subterrainean
extension of the colliderings marked with a white line, which is printed
on the standard CERN postcard. Following the white line of the largest
ring on a regular map, it is remarkable that it crosses the French-Swiss
border four times. This deliberately position of a scientific apparatus,
which has been set up, does not only reflect the wish for cooperation
across borders. One peculiarity of this situation is the extension
of a technical tool, an apparatus, up to the size of a real territory.
"What we can find here is a new kind of terrritory, beyond geographical,
political and cultural references, stretched out on its own borders.
These borders are represented - comparable to those of worldwide communication
networks - in the extension of the wholeness of the apparatus. They
mark the frontlines between existing points of view about the world,
and the future view points from where we look upon and create the
world." (1). "Humbled by his insignificance man looks up at the night
sky and wonders... ...less visible but no less impressive is the structure
of the universe on the microscopic scale as revealed by particle physics
experiments. Physics aims to discover universal laws, so that knowledge
gained by experiments under one set of conditions can be generalized.
" Never that humble, man did not stop to ask all kinds of questions
about what he observes, what it means and especially what consequences
it brings for himself. It started off with images and myths and throughout
different strings of history it became myriads of ways, impossible
to be all mentioned. Nevertheless they all have in common, a special
way to look at something "outside", on to a world which exists as
an opposite but which we are a part of at the same time. Therefore,
each attempt, each perspective devoted to knowledge, always contains
a reflexive dimension. To slow down the highspeed jump from the night
sky into the microcosm, we are now going to point out and combine
several 'moments of
Where
you can participate in one of mankinds greatest adventures Guided
tours in and around CERN Science as an attraction, the scientist as
a pioneer fighting his way through the jungel of unknown spaces. We
take part in "The Adventure of Science" ( the title of a German TV-series),
being guided through the panoptica of microscopic worlds, stunned
by the apparently endless variety and richness of physical microstructures
and the empty space connecting them. It is about truth and Beauty,
strange and Charm, UP and DOWN – there are the terms for the smallest
particles of matter whose existence has ever been proved. We are at
CERN, the Europeen Laboratory for Particle Physics, one of the world's
largest scientific laboratories. It stretches out on both sides of
the French-Swiss border, just west of the city of Geneva. There the
scientists deal with frontline research, pure science - particle physics
- probing the inner most constituents of matter to find out how our
world and the whole of the Universe works. To achieve this, they use
the world's largest scientific machine - the LEP electron-positron
collider. To protect the highly sensitive experiments against influence
by cosmic rays, almost the whole technical site (colliderrings, detectors,
laboratories) is installed under ground, varying in depth from 50
to 150 meters. There, beams of electrons and their counterpart, positrons,
are whirled round in a 27 kilometers underground ring to within a
hair's breadth of the speed of light and smashed together. Four mighty
detectors, each as big as a four-storey building, are spaced round
the ring to intercept, record and analyse the emerging fragments of
matter. Under the skilled guidance of a physicist ( as promised in
the CERN advertisement), the basic terms and processes become clearer
throughout the tour. After descending with the elevator down to a
hundred meters, you are fascinated by the gigantic detectors and after
glancing into the tunnel where the engineers installed the longest
vaccum on earth in an unspectecular tube, in which they speed up particles
to nearly the speed of light and and and.. - you can no longer deny
the futuristic charm and hold back your admiration for such exceptional
technology. Neither Disney nor Spielberg could have thought of a better
background for an enterprise with the title 'frontline research'.
But however futuristic and 'science fiction' the surrounding may appear,
working with these tools is a lot more prosaic. The visually striking
images of explosions, which are a result of the collisions inside
the detectors, aren't so much a reason to dream and speculate as to
work hard and long on counting, measuring and endless calculations.
That is part of the job of the more than 3000 employees of CERN. Moreover,
teams of scientists, and universities from all over the world take
part in the numerous experiments carried out with the LEP. To avoid
making the results subject to national or institutional interests,
they are discussed in open meetings and published in various media.
CERNs aim is pure science with no immediate technological or commercial
objectives. But the actual reason to come to Geneva are not only the
promises of the advertisement-brochure. In fact, this is something
you discover later on in the institutes' own souvenir shop, between
videos, buttons, baseball caps, t-shirts, cups, books and the recording
of the all-women-band "Les Horrible Cernettes" ( who definetly keep
their promise). There you can also find an aerial view of the region
between Lake Geneva and the French Jura mountains, with the subterrainean
extension of the colliderings marked with a white line, which is printed
on the standard CERN postcard. Following the white line of the largest
ring on a regular map, it is remarkable that it crosses the French-Swiss
border four times. This deliberately position of a scientific apparatus,
which has been set up, does not only reflect the wish for cooperation
across borders. One peculiarity of this situation is the extension
of a technical tool, an apparatus, up to the size of a real territory.
"What we can find here is a new kind of terrritory, beyond geographical,
political and cultural references, stretched out on its own borders.
These borders are represented - comparable to those of worldwide communication
networks - in the extension of the wholeness of the apparatus. They
mark the frontlines between existing points of view about the world,
and the future view points from where we look upon and create the
world." (1). "Humbled by his insignificance man looks up at the night
sky and wonders... ...less visible but no less impressive is the structure
of the universe on the microscopic scale as revealed by particle physics
experiments. Physics aims to discover universal laws, so that knowledge
gained by experiments under one set of conditions can be generalized.
" Never that humble, man did not stop to ask all kinds of questions
about what he observes, what it means and especially what consequences
it brings for himself. It started off with images and myths and throughout
different strings of history it became myriads of ways, impossible
to be all mentioned. Nevertheless they all have in common, a special
way to look at something "outside", on to a world which exists as
an opposite but which we are a part of at the same time. Therefore,
each attempt, each perspective devoted to knowledge, always contains
a reflexive dimension. To slow down the highspeed jump from the night
sky into the microcosm, we are now going to point out and combine
several 'moments of  this
endless story. Therefore, we go back to Geneva and we enter the "Musé
e D' Art et D'Histoire" to start with the probably most remarkable
painting of the collection. In the year 1444, the German painter Konrad
Witz gets the order to work on the tableaux for the altar of the dome
of Geneva. On the four still existing pictures, the painting called
"Der wunderbare Fischzug" is definetly the most famous. This painting
shows, for the very first time, a view beyond a religious, allegoric
scene onto a real, locally given, recognizable sujet. Neither the
action, nor the people stand in the foreground, but the interest for
showing a realistic, an excisting landscape. The discovery of the
landscape marks the breakthrough of a consciousness of space. An undistanced
relation to the world is torn apart in the exact moment, when a part
of nature is being taken out of the entire picture by a subjective
view, and it turns into a piece of land which is actually created
by this view. Konrad Witz paints a part of the Lake Geneva, with lake
dwellings, fields and trees on the hills, in front of the Jura mountains.
The fact that an artist is trying to give a realistic 'copy' of a
landscape, is even more astonishing as the representation of geographical
facts in the form of maps, developed up to then, has not made any
progress during this periode of time. One can even observe a step
back, as far as the quality of recording is concerned, compared with
the achievements of former cultures. Precision and objectivity are
no prelimineries for the Middle Ages spirit.. Even though the maps
are based on detailed secular data, they mainly deal with visualising
imaginations about how the world is supposed to be. Finally, the Art
of mapping prospers not before the detachment from the clerical dogma
and the upcoming of intercontinental wars of conquest and the great
expeditions. Now mainly the scholars, fascinated by astronomy and
mathematics, like G.Mercator and W.-J. Blaeu, succeed in the 17th
century to combine their geographical knowledge with their abilities
of drawing and copperplate-engraving, to create new views of the world.
Supported by the booming developement of the printing technology.
they publish their revised maps in the form of atlases. Nevertheless
it remains difficult to achieve an exact determination of the longitude
and latitude and to reconcile the sometimes contractionary reports
given by navigators and travellers. Thist lasts till the 18th century,
which gives a platform for deep changes in many fields of science.
It is than that cartography undergoes fundamental changes. The outstanding
results of Sir Isaac Newtons researches in mathematics and astronomy,
now find a practical use. The movements of the stars can now be measured
and predicted, so that it is possible to fix the latitudes up to an
accuracy of less than one degree. Parallel to these developments,
the progress in the invention and construction of measuring instruments,
contribute to a better precision and constantly improve the possibilities
of navigators and cartographs during the 18th and 19th century. With
the new instruments it is possible to get reliable data of the geographical
facts and to relate the various reports and results to each other
in order to give realistic views. Following this rough sketch, starting
in the Middle Ages out of the dominating frame of Christian belief,
it seems that man focuses more and more on the observeable, measurable
phenomena of the physical world, proceeded by the growing perfection
of the recording and depicting instruments. Trying to visualize images
or. imaginations about the world in the beginning and subordinating
scientific results to ideological interpretation makes it easy - if
not nescessary - to refrain from the further developement of tools
and instruments and to concentrate the asthetics of the representation.
But in the course of time, with the newly developed instruments, the
perfection of precision and the discovery of external and abstract
references (stars, mathematics,...), the question of representation
is to be redefined. Representation is no longer submitted to a certain
religious ideology. Via depiction of data and the results of scientific
experiments, the image of the world in our minds gradually changes.
Getting used to the utilisation of technical instruments and the necessity
to look through these tools, from the ground up to the sky and via
mathematical abstraction back to earth, it becomes obviously obligatory
to leave 'the ground of facts' to be able to overlook the world's
new complexcity. aeronautics On november 21st, 1783, the ballon of
the brothers Montgolfier accends for the first time in Paris and opens
up a totally new perspective to the pioneers. Looked at from above
the view onto the earths surface, with cities, nets of roads, parcels
of land, fields and woods, reminds us of a view onto a drawn map.
The sight suddenly turns into an overlook and leads to new patterns
of a direct conception like it used to be possible only in the fragmentary
view of the navigators and cartographs. The look onto a 'real map'
confuses the central perspective gained only recently as an orientation
in the world. What has been put together from fragments of data before,
now opens up in a puzzling synchronization. The observer leaves his
object of observation for the first time and finds himself in a seemingly
neutral distance, giving the impression of objectivity. On the other
hand there is the loss of a single fixed point of perspective. photography
The process and attempts to reproduce what the eye can see is continued
at the end of the 18th century by the means of photography .After
overcoming some technical obstacles, it developes relativly fast into
an extremely popular media, based on the fact that it gives the 'correct'
perspective automatically. By photo optics the central, colour and
aerial perspective appears as a matter-of-course. It is one of the
most renowned photographers, Felix Gaspard Tournachon, called Nadar,
who recognizes and translates into action the new possibilities. Whereas
his focus is less on the technical aspects of the new media, he concentrates
on exceptional recording situations. Parallel to his experiments with
electric light to gain pictures of the Paris catacombs, he is passionately
devoted to flying hot air balloons in 1857, he undertakes his first
flight in order to produce aerial photographs. He succeeds a year
later after managing the problem of films being destroyed by the balloon
gas. Shortly aftewards he registers his patent for 'aerostatic photos'.
Together with his balloon "G¨ant", these pictures assured Nadar world-wide
recognition. Apart from that, another peculiarity of the photographic
technology is of importance. In addition to the sharpness and the
perspective, there is the possibility to fix the transitoriness and
to give continuance to the moment. In a fragment of a seconds, one
can fulfill what used to take hours and days. In these increasingly
shorter periods, events became visible which no one would have had
the slight idea about without the photographic process. The new technology
allows not only to rationalize the process of the image, but to open
up more and more a view into the microcosm of time. cosmic rays Some
years later, at the beginning of the 19th century, a surprising discovery
is made in the field of physics. Some physicists suppose that the
earth is being bombarded with cosmic particles, which on their way
charge the air with electricity. The physicist Victor F. Hess, who
did a lot of research in this field, ascended in 1912 with a hot-air
balloon to test and finally provef the conductivity of air in high
altitudes. Though the 'cosmic particles' could be measured, it still
was not possible to give any reliable statements about their 'behaviour'.
Again, the photographic technology, i.e. the photographic emulsion
- offers help. The trajectory of particles, passing the emulsion are
made visible in the form of chains of tiny silver chloride grains.
That as well as the cloud chamber became the most important instrument
of particle physics till the
this
endless story. Therefore, we go back to Geneva and we enter the "Musé
e D' Art et D'Histoire" to start with the probably most remarkable
painting of the collection. In the year 1444, the German painter Konrad
Witz gets the order to work on the tableaux for the altar of the dome
of Geneva. On the four still existing pictures, the painting called
"Der wunderbare Fischzug" is definetly the most famous. This painting
shows, for the very first time, a view beyond a religious, allegoric
scene onto a real, locally given, recognizable sujet. Neither the
action, nor the people stand in the foreground, but the interest for
showing a realistic, an excisting landscape. The discovery of the
landscape marks the breakthrough of a consciousness of space. An undistanced
relation to the world is torn apart in the exact moment, when a part
of nature is being taken out of the entire picture by a subjective
view, and it turns into a piece of land which is actually created
by this view. Konrad Witz paints a part of the Lake Geneva, with lake
dwellings, fields and trees on the hills, in front of the Jura mountains.
The fact that an artist is trying to give a realistic 'copy' of a
landscape, is even more astonishing as the representation of geographical
facts in the form of maps, developed up to then, has not made any
progress during this periode of time. One can even observe a step
back, as far as the quality of recording is concerned, compared with
the achievements of former cultures. Precision and objectivity are
no prelimineries for the Middle Ages spirit.. Even though the maps
are based on detailed secular data, they mainly deal with visualising
imaginations about how the world is supposed to be. Finally, the Art
of mapping prospers not before the detachment from the clerical dogma
and the upcoming of intercontinental wars of conquest and the great
expeditions. Now mainly the scholars, fascinated by astronomy and
mathematics, like G.Mercator and W.-J. Blaeu, succeed in the 17th
century to combine their geographical knowledge with their abilities
of drawing and copperplate-engraving, to create new views of the world.
Supported by the booming developement of the printing technology.
they publish their revised maps in the form of atlases. Nevertheless
it remains difficult to achieve an exact determination of the longitude
and latitude and to reconcile the sometimes contractionary reports
given by navigators and travellers. Thist lasts till the 18th century,
which gives a platform for deep changes in many fields of science.
It is than that cartography undergoes fundamental changes. The outstanding
results of Sir Isaac Newtons researches in mathematics and astronomy,
now find a practical use. The movements of the stars can now be measured
and predicted, so that it is possible to fix the latitudes up to an
accuracy of less than one degree. Parallel to these developments,
the progress in the invention and construction of measuring instruments,
contribute to a better precision and constantly improve the possibilities
of navigators and cartographs during the 18th and 19th century. With
the new instruments it is possible to get reliable data of the geographical
facts and to relate the various reports and results to each other
in order to give realistic views. Following this rough sketch, starting
in the Middle Ages out of the dominating frame of Christian belief,
it seems that man focuses more and more on the observeable, measurable
phenomena of the physical world, proceeded by the growing perfection
of the recording and depicting instruments. Trying to visualize images
or. imaginations about the world in the beginning and subordinating
scientific results to ideological interpretation makes it easy - if
not nescessary - to refrain from the further developement of tools
and instruments and to concentrate the asthetics of the representation.
But in the course of time, with the newly developed instruments, the
perfection of precision and the discovery of external and abstract
references (stars, mathematics,...), the question of representation
is to be redefined. Representation is no longer submitted to a certain
religious ideology. Via depiction of data and the results of scientific
experiments, the image of the world in our minds gradually changes.
Getting used to the utilisation of technical instruments and the necessity
to look through these tools, from the ground up to the sky and via
mathematical abstraction back to earth, it becomes obviously obligatory
to leave 'the ground of facts' to be able to overlook the world's
new complexcity. aeronautics On november 21st, 1783, the ballon of
the brothers Montgolfier accends for the first time in Paris and opens
up a totally new perspective to the pioneers. Looked at from above
the view onto the earths surface, with cities, nets of roads, parcels
of land, fields and woods, reminds us of a view onto a drawn map.
The sight suddenly turns into an overlook and leads to new patterns
of a direct conception like it used to be possible only in the fragmentary
view of the navigators and cartographs. The look onto a 'real map'
confuses the central perspective gained only recently as an orientation
in the world. What has been put together from fragments of data before,
now opens up in a puzzling synchronization. The observer leaves his
object of observation for the first time and finds himself in a seemingly
neutral distance, giving the impression of objectivity. On the other
hand there is the loss of a single fixed point of perspective. photography
The process and attempts to reproduce what the eye can see is continued
at the end of the 18th century by the means of photography .After
overcoming some technical obstacles, it developes relativly fast into
an extremely popular media, based on the fact that it gives the 'correct'
perspective automatically. By photo optics the central, colour and
aerial perspective appears as a matter-of-course. It is one of the
most renowned photographers, Felix Gaspard Tournachon, called Nadar,
who recognizes and translates into action the new possibilities. Whereas
his focus is less on the technical aspects of the new media, he concentrates
on exceptional recording situations. Parallel to his experiments with
electric light to gain pictures of the Paris catacombs, he is passionately
devoted to flying hot air balloons in 1857, he undertakes his first
flight in order to produce aerial photographs. He succeeds a year
later after managing the problem of films being destroyed by the balloon
gas. Shortly aftewards he registers his patent for 'aerostatic photos'.
Together with his balloon "G¨ant", these pictures assured Nadar world-wide
recognition. Apart from that, another peculiarity of the photographic
technology is of importance. In addition to the sharpness and the
perspective, there is the possibility to fix the transitoriness and
to give continuance to the moment. In a fragment of a seconds, one
can fulfill what used to take hours and days. In these increasingly
shorter periods, events became visible which no one would have had
the slight idea about without the photographic process. The new technology
allows not only to rationalize the process of the image, but to open
up more and more a view into the microcosm of time. cosmic rays Some
years later, at the beginning of the 19th century, a surprising discovery
is made in the field of physics. Some physicists suppose that the
earth is being bombarded with cosmic particles, which on their way
charge the air with electricity. The physicist Victor F. Hess, who
did a lot of research in this field, ascended in 1912 with a hot-air
balloon to test and finally provef the conductivity of air in high
altitudes. Though the 'cosmic particles' could be measured, it still
was not possible to give any reliable statements about their 'behaviour'.
Again, the photographic technology, i.e. the photographic emulsion
- offers help. The trajectory of particles, passing the emulsion are
made visible in the form of chains of tiny silver chloride grains.
That as well as the cloud chamber became the most important instrument
of particle physics till the  1960s.
part 3 At the end of this trip to event which had an influence on
how we look at the world and how we orientate ourselves, we are back
to CERN. Here we are going to start the third part of our visit to
the region of Geneva. Early in the morning we leave the central site
of CERN, near Meyrin, cross - after only a few meters - the border
to France and stick to the main road to St.-Genis-Pouilly. Passing
by the Centre culturel, we leave the plastered roads and wander across
field, towards some unobstrusive concrete buildings - the only visible
hint of the first detector. We leave them behind and march on, across
meadows, fields woods, passing farms and villages, Chevry, Nazdessous
and get near Echenevex. Again we pass a detector, before we turn,
westward, near La Table Ronde. After a while, we discover in the open
field two more CERN buildings. From there on we turn to Versonnex
and cross the location on several by-streets a little later. A bit
further west, shortly behind the large housing estate of Le Bois Chatton,
on the French-Swiss border, we find the next indications of a detector.in
the middle of the forrest Right after, we cross the green border into
Switzerland, follow a wide curve throgh Bossy and Collex, and return
to France near Ferney-Voltaire. In the evening twilight ,we walk through
the small town, keeping on the main road to Meyrin. We cross the border
for the last time, pass through the subburb Les Vernes, and reach
the centre of the Swiss town Meyrin. From here it is just one more
kilometer to our point of departure, where we arrive at the beginning
of darkness. We followed the subterranean course of the collider-rings
in the area between the Jura mountains and the Lake Geneva. To facilitate
orientation, we used detailed fieldmaps and the standard postcard
taken from the CERN souvenir-shop, showing an aerial view of the whole
site. The trace of the walk results in a map, which resembles the
boundaries of a classical territory. The video recording of the trip
could be looked at as a kind of 'temporal panorama' of the whole scientific
apparatus, which does not only focus on the extraordinary technology
used achieve an even more accurate image of the world. It is mainly
our interest in the form of the instrument which is used and its geographical,
social, historic and political as well as perceptional aspects that
made us undertake this trip.
1960s.
part 3 At the end of this trip to event which had an influence on
how we look at the world and how we orientate ourselves, we are back
to CERN. Here we are going to start the third part of our visit to
the region of Geneva. Early in the morning we leave the central site
of CERN, near Meyrin, cross - after only a few meters - the border
to France and stick to the main road to St.-Genis-Pouilly. Passing
by the Centre culturel, we leave the plastered roads and wander across
field, towards some unobstrusive concrete buildings - the only visible
hint of the first detector. We leave them behind and march on, across
meadows, fields woods, passing farms and villages, Chevry, Nazdessous
and get near Echenevex. Again we pass a detector, before we turn,
westward, near La Table Ronde. After a while, we discover in the open
field two more CERN buildings. From there on we turn to Versonnex
and cross the location on several by-streets a little later. A bit
further west, shortly behind the large housing estate of Le Bois Chatton,
on the French-Swiss border, we find the next indications of a detector.in
the middle of the forrest Right after, we cross the green border into
Switzerland, follow a wide curve throgh Bossy and Collex, and return
to France near Ferney-Voltaire. In the evening twilight ,we walk through
the small town, keeping on the main road to Meyrin. We cross the border
for the last time, pass through the subburb Les Vernes, and reach
the centre of the Swiss town Meyrin. From here it is just one more
kilometer to our point of departure, where we arrive at the beginning
of darkness. We followed the subterranean course of the collider-rings
in the area between the Jura mountains and the Lake Geneva. To facilitate
orientation, we used detailed fieldmaps and the standard postcard
taken from the CERN souvenir-shop, showing an aerial view of the whole
site. The trace of the walk results in a map, which resembles the
boundaries of a classical territory. The video recording of the trip
could be looked at as a kind of 'temporal panorama' of the whole scientific
apparatus, which does not only focus on the extraordinary technology
used achieve an even more accurate image of the world. It is mainly
our interest in the form of the instrument which is used and its geographical,
social, historic and political as well as perceptional aspects that
made us undertake this trip.
Wissenschaft als Attraktion, der Forscher als Pionier der sich durch
den Dschungel fremder Welten kämpft. Wir haben Teil am "Abenteuer
Forschung", indem wir durch das Panoptikum mikroskopischer Welten
geführt werden, staunend über die unendlich scheinende Fülle
physikalischer Kleinstkörper und die Leere die sie verbindet.
Es geht um TRUTH und BEAUTY, STRANGE und CHARM, UP und DOWN, so jedenfalls
die Bezeichnungen für die kleinsten bisher nachgewiesenen Bausteine
der Materie. Wir befinden uns am CERN (conseil europé en pour
la recherche nuclé aire), dem europäischen Forschungszentrum
für Teilchenphysik, einem der größten naturwissenschaftlichen
Laboratorien der Welt das sich beiderseits der französisch-schweizerischen
Grenze, westlich von Genf erstreckt. Die Wissenschaftler befassen
sich dort mit Grundlagenforschung im Bereich der Teilchenphysik. Sie
untersuchen kleinste Bausteine der Materie, um herauszufinden nach
welchen Gesetzen unsere Welt bzw. das ganze Universum funktionieren.
Hierzu bedienen sie sich der derzeit größten wissenschaftlichen
'Maschine' der Welt, des Elektronen-Positronen-Kolliderrings LEP.
Um die hochempfindlichen Versuche gegen Einflüße durch
kosmische Strahlung zu schützen, wurde fast die komplette technische
Anlage: Beschleunigerringe, Detektoren, Labors, usw. in etwa 100 m
Tiefe unter der Erdoberfläche installiert. Dort werden Elektronen,
ihre Gegenstücke aus Antimaterie und Positronen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit
in dem 27 Kilometer langen Ring beschleunigt und prallen dann aufeinander.
Die dabei entstehenden Materiebruchstücke werden von vier, über
den Ring verteilten Detektoren - jeder etwa so groß wie ein
vierstöckiges Haus aufgefangen, aufgezeichnet und analysiert.
Unter geschulter Führung einer Physikerin (wie im Prospekt versprochen)
werden sich uns im Laufe dieses Rundganges wenigstens die grundlegenden
Begriffe im Ü berblick erhellen. Die Werbung verheißt:
"Diese großartigen Instrumente an der Spitze der Technologie
gehören zu den Prachtstücken der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts.".
Und tatsächlich, nach einer Fahrt mit dem Aufzug in die Tiefe,
steht man fasziniert vor den gigantischen Detektoren und auch nach
einem Blick in den Tunnel, der in einer eher unscheinbaren Röhre
das "längste Vakuum der Welt" birgt, in dem die Teilchen auf
nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und, und, und, ....,
kann man sich dem futuristischen Charme und der Bewunderung solch
außergewöhnlicher Technik kaum mehr entziehen. Weder Disney
noch Spielberg hätten sich eine bessere Kulisse erdenken können,
als Hintergrund für eine Unternehmung die allgemein als "frontline
research", Grundlagenforschung bezeichnet wird (wobei das Englische
wohl den besseren Filmtitel parat hält). So futuristisch das
Ambiente, soviel science fiction hier versammelt scheint, die Arbeit
mit diesen Anlagen sieht schon wesentlich nüchterner aus. Die
spektakulär anmutenden Explosionszeichnungen die sich bei den
Kollisionen im Inneren der Detektoren ereignen, sind eben weniger
Anlaß zum träumen und spekulieren, als zu langwieriger
Auszählungs-, und Berechnungsarbeit. Dafür sind die 3000
Beschäftigten des CERN zuständig. Darüberhinaus sind
an den einzelnen Experimenten mit dem LEP, sowie an den zahlreichen
anderen Forschungsprojekten, Wissenschaftsteams bzw. Universitäten
aus der ganzen Welt beteiligt. Um die Forschungsergebnisse nicht nationalen
oder institutionellen Interessen unterzuordnen, werden sie in öffentlichen
Sitzungen diskutiert und in Fachzeitschriften veröffentlicht,
sind also immer frei zugänglich. Durch eine weitgehend gesicherte
Finanzierung des Forschungsapparates (Jahreshaushalt ca. 900 Mio.
SF), entsteht hier die Möglichkeit sich vom Zwang zur Entwicklung
und Produktion kommerziell verwertbarer Technik weitgehend freizuhalten.
Der eigentliche Anlaß die Reise nach Genf zu unternehmen sind
nicht nur die reißerischen Versprechen der Werbebroschüre
des CERN. Die entdeckt man erst später im Souvenirshop des Instituts,
zwischen Videos, Anstecknadeln, Baseballkappen, T-Shirts, Tassen,
Büchern und den Kasetten der hauseigenen Frauenband "Les Horribles
Cernettes" (die ihr Versprechen halten). Dort findet sich auch eine
Luftaufnahme der Gegend zwischen Genfer See und französischem
Jura, mit dem eingezeichneten Verlauf der unterirdischen Beschleunigerringe,
abgebildet auf der Standard-Postkarte des CERN. Folgen wir der Markierung
des größten Ringes ist zu erkennen, daß dieser viermal
die Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz überquert. Diese
bewußt gesetzte Lage eines wissenschaftlichen Apparates spiegelt
nicht nur das Anliegen nach grenzüberschreitender Zusammenarbeit
wieder. Eine Besonderheit liegt eben gerade darin, daß es sich
um die Ausdehnung eines Apparates in eine territoriale Größenordung
handelt. "What we can find now is a new kind of terrritory, beyond
geographical, political and cultural references, stretched out on
its own borders. These borders are represented - comparable to those
of worldwide communication networks - in the extension of the wholeness
of the apparatus. They mark the frontlines between existing points
of view about the world, and the future view points from where we
look upon and create the world." (2). "Humbled by his insignificance
Man looks up at the night sky and wonders" "Beim Anblick des nächtlichen
Sternenhimmels wird der Mensch bescheiden vor solcher Unermesslichkeit
und stellt sich Fragen. Nicht weniger eindrucksvoll ist der dem bloßen
Auge verborgene Aufbau des Universums auf mikroskopischer Ebene, wie
ihn die Teilchenphysikexperimente enthüllen. Das Ziel der Physik
ist die Entdeckung universeller Gesetze, anhand derer die unter gewissen
experimentellen Bedingungen gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinert
werden können. ..." So bescheiden ist der Mensch dann doch nicht
daß er es nicht wagen würde Fragen zu stellen, Fragen nach
dem was er da sieht, was es bedeutet, in welchem Zusammenhang es mit
ihm steht (spätestens hier ist es mit der Bescheidenheit vorbei),
wie er sein Wissen in einen praktischen Lebenszusammenhang bringen
könnte und vieles mehr. Mit Bildern und Mythen fängt die
Geschichte an und verzweigt sich immer mehr und läßt sich
in seinen Einzelheiten auch gar nicht mehr fassen. Gemeinsam ist dennoch
den meisten Versuchen der Blick nach "draußen", auf eine Welt
der man gegenübersteht, deren Teil man aber zugleich ist. Daher
war und ist, wie wir bereits gesehen haben, jeder Versuch der sich
dem Erkennen widmet, immer auch mit einer reflexiven Dimension verknüpft.
Im folgenden sollen einige Momente aus dieser unendlichen Geschichte
herausgegriffen werden und zugegebenermaßen assoziativ aneinandergestellt
werden, um den Sprung vom Sternenhimmel zum Mikrokosmos durch kurze
 Zwischenlandungen
etwas weniger abrupt zu gestalten. Kehren wir dazu nach Genf zurück,
begeben uns in das Musé e d'Art et d'Histoire und beginnen
bei dem wohl berühmtesten Gemälde der dortigen Sammlung.
Im Jahr 1444 erhält der deutsche Maler Konrad Witz den Auftrag
die Tafelbilder für einen Altar des Genfer Domes zu malen. Von
den vier noch erhaltenen Tafeln ist "Der wunderbare Fischzug" das
wohl bekannteste Gemälde. An diesem Bild zeigt sich zum erstenmal
nördlich der Alpen, ein Blick, durch eine religiöse, allegorische
Szene hindurch auf ein reales, vor Ort gegebenes, wiedererkennbares
Sujet. Nicht die Handlung, die Personen, stehen eigentlich im Vordergrund,
sondern das Interesse an einer möglichst exakten Wiedergabe einer
real existierenden Landschaft. Die Entdeckung der Landschaft illustriert
dabei den Durchbruch eines Raumbewußtseins. Eine undistanzierte
Bindung an die Welt, zereißt in dem Moment, da ein Teil der
Natur durch einen subjektiven Blick räumlich aus dem Ganzen herausgelöst,
zu einem Stück Land wird, das der Blick erst schafft. Konrad
Witz malt einen Ausschnitt des Genfer Sees, an dessen Ufer Pfahlbauten
stehen und sich hinter baumbestandenen Hügeln, die Berge erheben.
Die biblische Szene bleibt Staffage. Die reale Landschaft ist hier
subjektivistische, individuelle "Beigabe"; der Verweis auf das Gute,
Wahre, Schöne hinter dem Bild trägt hier keine religiösen
Klammern, sondern öffnet eine neue Sichtweise auf die Welt wie
sie von den Menschen des Mittelalters kaum gewagt werden konnte. Der
Blick nach "draußen", auf eine Welt außerhalb von Vorschriften
und Regeln, Gesetzen und Geboten, stellt eben jene in Frage und verlangt
nach einer neuen Interpretation und einem veränderten Verständnis
der eigenen Wirklichkeit. Die Tatsache, daß ein Künstler
sich um eine realitätsgetreue Abbildung einer Landschaft bemüht,
ist umso erstaunlicher, als die bis dato entwickelte Form der Wiedergabe
geographischer Gegebenheiten durch die Erstellung von Landkarten,
sich in dieser geschichtlichen Periode nicht weiter entwickelt hatte.
Mehr noch, das Kartenwesen des Mittelalters stellt im Hinblick auf
die Aufzeichnungsqualität tatsächlicher geographischer Verhältnisse,
gegenüber dem bereits von vorangegangenen Kulturen Erreichtem,
einen Rückschritt dar. Genauigkeit und Objektivität sind
in dieser Hinsicht keine vorrangigen Ziele für den mittelalterlichen
Geist. Wenn auch die Karten auf ausführlichen Daten aus dem weltlichen
Bereich basieren, den Realitäten der physischen Welt wird weniger
Beachtung geschenkt. Sie befassen sich mehr mit der Verbildlichung
von Weltvorstellungen. Im Grunde erst mit der stückweisen Ablösung
vom kirchlichen Dogma, den großen Entdeckungsreisen und den
einsetzenden 'interkontinentalen' Kriegen, entwickelt sich das Kartenwesen
zu neuer Blüte. Es sind jetzt vor allem die von der Astronomie
und Mathematik faszinierten Gelehrten wie Gerhard Mercator und Willem
Janszoon Blaeu, denen es im ausgehenden 16. und 17. Jahrhundert gelingt,
ihr Wissen von Geographie, mit den Fähigkeiten des Zeichnens
und Stechens zu verbinden und so ein neues Bild der Welt zu erstellen.
Unterstützt von der sich rasch entwickelnden Drucktechnik, verbreiten
sie das von ihnen überarbeitete Kartenmaterial in Form mehrbändiger
Atlanten. Aber nicht in jede neue Auflage wird Korrekturen und neue
geographische Erkenntnisse eingearbeitet. Da die Druckplatten und
-stöcke jedesmal neu graviert werden müssen, sind Korrekturen
nicht so einfach durchführbar, so daß Anachronismen oft
über Jahre und bisweilen Jahrzehnte fortgeschleppt werden. Es
ist auch problematisch eine exakte Bestimmung der geographischen Längen
und Breiten vorzunehmen, sowie die sich oft widersprechenden Berichte
von Reisenden und Seefahrern miteinander in Einklang zu bringen. Es
dauert bis ins 18. Jahrhundert, das zum Schauplatz weitreichender
Veränderungen auf vielen Feldern der Wissenschaft wird, bis die
Kartographie eine grundlegende Reform erlebt. Die bahnbrechenden Erkenntnisse
die Isaac Newton für die Mathematik und Astronomie formuliert,
kommen nun zur praktischen Anwendung. Die Bewegung der Himmelskörper
wird zum Gegenstand exakter Berechnung, so daß nun genaue Vorhersagen
über weit in die Zukunft reichende Zeiträume möglich
sind. Darüberhinaus kann man mit Hilfe von Mondentfernungstabellen
die geographische Länge, dank der Newtonschen Gleichungen, mit
einer Genauigkeit bis auf weniger als ein Grad bestimmen. Zeitgleich
tragen die Fortschritte die beim Bau von Meßinstrumenten erzielt
werden, ebenfalls zu größerer Präzision bei und verbessern
ständig die Möglichkeiten der Landvermesser und Seefahrer.
Mit den neuen Präzisionsinstrumenten sind die Kartographen nunmehr
in der Lage, exakte geodätische Vermessungen vorzunehmen, verläßliche
Daten über die Oberfläche der Erde zu erhalten, diese in
Relation zu bereits vorhandenen Erkentnissen zu stellen und in Form
von Karten abzubilden. Durch die hier in Kürze nachskizzierte
Entwicklung aus dem Mittelalter, aus der Umklammerung durch christliche
Weltvorstellungen heraus, kommt man zu einer Orientierung an beobachtbaren,
meßbaren Phänomenen der physischen Welt, die von einer
Perfektionierung der Aufnahme- und Abbildungsinstrumentarien vorangetrieben
werden und somit entstehen neue Möglichkeiten der Weltbeschreibung.
Man versucht anfangs noch ein Weltbild zur Anschauung zu bringen und
ordnet sämtliche Forschungsergebnisse den ideologischen Deutungen
unter. Dabei kann man auch getrost auf die Weiterentwicklung der Meßapparaturen
verzichten und sich auf die ästhetische Qualitäten der Abbildungen
konzentrieren. Am Beispiel des Bildes "Der wunderbare Fischzug" wird
, in einer Art Vorgriff, das Streben nach objektiver, ideologisch
unverstellter Anschauung der realen Welt deutlich. Der weitere Weg
wird anhand der Entwicklung des Kartenwesens anschaulich. Mit den
Vermessungen der See- und Landgebiete stösst man bald an technische
Grenzen, da die tatsächlichen Relationen zueinander und der jeweilige
Standort des Beobachters nur ungenau zu bestimmen sind. Daher ist
es notwendig geworden, unter anderem auch einen externen Bezugspunkt
zu finden, der als eine Art allgemein verbindlicher, 'perspektivischer
Fluchtpunkt' dienen kann. Dazu verlässt man den Beobachtungsgegenstand
'Erde' und beginnt sich an den Gestirnen zu orientieren, bzw. an allgemein
verbindlichen, abstrakten Unterteilungen (Zeiteinheiten, Gradeinteilung,
usw.). Mit den neu entwickelten Apparaturen, der größeren
Meßgenauigkeit und den externen, abstrakten Bezugsfeldern, wird
gleichzeitig die Frage der Darstellbarkeit neu formuliert. Die Darstellung
steht nun nicht länger im Dienste einer Weltanschauung, sondern
über die Verbildlichung von Daten und Ergebnissen der Wissenschaft
wandelt sich das Bild der Welt in unseren Köpfen. Man gewöhnt
sich an den Gebrauch der Apparate und an die Notwendigkeit des Blickes
durch sie hindurch, von unten nach oben und von dort, über die
Abstraktion der Mathematik wieder auf die Welt. Es ist buchstäblich
notwendig geworden den Boden der Tatsachen zu verlassen, um ihn in
seiner neuen Komplexität erfassen zu können. Aeronautik
Am 21.11 1783 steigt in Paris zum ersten Mal der Ballon der Gebrüder
Montgolfier in den Himmel auf und eröffnet den Pionieren einen
vollkommen neuen Blick auf ihre Umgebung. Von oben betrachtet erinnert
die Ansicht der Erdoberfläche, dem Städteraster und Wegenetzen,
den Parzellen aus Feldern, Wäldern, an den Blick auf eine gezeichnete
Landkarte. Die Ansicht wird ihnen plötzlich zur Ü bersicht
und es ergeben sich neue Muster der direkten Anschauung, wie sie bisher
nur in der zeitlich gedehnten, gestückelten Betrachtung des Landvermessers
und der des Kartographen angedeutet war. Der Blick auf eine "reale
Karte", verwirrt die gerade erst gewonnene zentralperspektivische
Sicht auf die Welt. Was zuvor über die zeitlich gedehnte Vermessung
einzelner Abschnitte, das Fixieren einzelner Daten erst zu einem Geamtbild
gefügt wurde, eröffnet sich nun dem menschlichen Auge in
verwirrender Gleichzeitigkeit. Nun verläßt der
Zwischenlandungen
etwas weniger abrupt zu gestalten. Kehren wir dazu nach Genf zurück,
begeben uns in das Musé e d'Art et d'Histoire und beginnen
bei dem wohl berühmtesten Gemälde der dortigen Sammlung.
Im Jahr 1444 erhält der deutsche Maler Konrad Witz den Auftrag
die Tafelbilder für einen Altar des Genfer Domes zu malen. Von
den vier noch erhaltenen Tafeln ist "Der wunderbare Fischzug" das
wohl bekannteste Gemälde. An diesem Bild zeigt sich zum erstenmal
nördlich der Alpen, ein Blick, durch eine religiöse, allegorische
Szene hindurch auf ein reales, vor Ort gegebenes, wiedererkennbares
Sujet. Nicht die Handlung, die Personen, stehen eigentlich im Vordergrund,
sondern das Interesse an einer möglichst exakten Wiedergabe einer
real existierenden Landschaft. Die Entdeckung der Landschaft illustriert
dabei den Durchbruch eines Raumbewußtseins. Eine undistanzierte
Bindung an die Welt, zereißt in dem Moment, da ein Teil der
Natur durch einen subjektiven Blick räumlich aus dem Ganzen herausgelöst,
zu einem Stück Land wird, das der Blick erst schafft. Konrad
Witz malt einen Ausschnitt des Genfer Sees, an dessen Ufer Pfahlbauten
stehen und sich hinter baumbestandenen Hügeln, die Berge erheben.
Die biblische Szene bleibt Staffage. Die reale Landschaft ist hier
subjektivistische, individuelle "Beigabe"; der Verweis auf das Gute,
Wahre, Schöne hinter dem Bild trägt hier keine religiösen
Klammern, sondern öffnet eine neue Sichtweise auf die Welt wie
sie von den Menschen des Mittelalters kaum gewagt werden konnte. Der
Blick nach "draußen", auf eine Welt außerhalb von Vorschriften
und Regeln, Gesetzen und Geboten, stellt eben jene in Frage und verlangt
nach einer neuen Interpretation und einem veränderten Verständnis
der eigenen Wirklichkeit. Die Tatsache, daß ein Künstler
sich um eine realitätsgetreue Abbildung einer Landschaft bemüht,
ist umso erstaunlicher, als die bis dato entwickelte Form der Wiedergabe
geographischer Gegebenheiten durch die Erstellung von Landkarten,
sich in dieser geschichtlichen Periode nicht weiter entwickelt hatte.
Mehr noch, das Kartenwesen des Mittelalters stellt im Hinblick auf
die Aufzeichnungsqualität tatsächlicher geographischer Verhältnisse,
gegenüber dem bereits von vorangegangenen Kulturen Erreichtem,
einen Rückschritt dar. Genauigkeit und Objektivität sind
in dieser Hinsicht keine vorrangigen Ziele für den mittelalterlichen
Geist. Wenn auch die Karten auf ausführlichen Daten aus dem weltlichen
Bereich basieren, den Realitäten der physischen Welt wird weniger
Beachtung geschenkt. Sie befassen sich mehr mit der Verbildlichung
von Weltvorstellungen. Im Grunde erst mit der stückweisen Ablösung
vom kirchlichen Dogma, den großen Entdeckungsreisen und den
einsetzenden 'interkontinentalen' Kriegen, entwickelt sich das Kartenwesen
zu neuer Blüte. Es sind jetzt vor allem die von der Astronomie
und Mathematik faszinierten Gelehrten wie Gerhard Mercator und Willem
Janszoon Blaeu, denen es im ausgehenden 16. und 17. Jahrhundert gelingt,
ihr Wissen von Geographie, mit den Fähigkeiten des Zeichnens
und Stechens zu verbinden und so ein neues Bild der Welt zu erstellen.
Unterstützt von der sich rasch entwickelnden Drucktechnik, verbreiten
sie das von ihnen überarbeitete Kartenmaterial in Form mehrbändiger
Atlanten. Aber nicht in jede neue Auflage wird Korrekturen und neue
geographische Erkenntnisse eingearbeitet. Da die Druckplatten und
-stöcke jedesmal neu graviert werden müssen, sind Korrekturen
nicht so einfach durchführbar, so daß Anachronismen oft
über Jahre und bisweilen Jahrzehnte fortgeschleppt werden. Es
ist auch problematisch eine exakte Bestimmung der geographischen Längen
und Breiten vorzunehmen, sowie die sich oft widersprechenden Berichte
von Reisenden und Seefahrern miteinander in Einklang zu bringen. Es
dauert bis ins 18. Jahrhundert, das zum Schauplatz weitreichender
Veränderungen auf vielen Feldern der Wissenschaft wird, bis die
Kartographie eine grundlegende Reform erlebt. Die bahnbrechenden Erkenntnisse
die Isaac Newton für die Mathematik und Astronomie formuliert,
kommen nun zur praktischen Anwendung. Die Bewegung der Himmelskörper
wird zum Gegenstand exakter Berechnung, so daß nun genaue Vorhersagen
über weit in die Zukunft reichende Zeiträume möglich
sind. Darüberhinaus kann man mit Hilfe von Mondentfernungstabellen
die geographische Länge, dank der Newtonschen Gleichungen, mit
einer Genauigkeit bis auf weniger als ein Grad bestimmen. Zeitgleich
tragen die Fortschritte die beim Bau von Meßinstrumenten erzielt
werden, ebenfalls zu größerer Präzision bei und verbessern
ständig die Möglichkeiten der Landvermesser und Seefahrer.
Mit den neuen Präzisionsinstrumenten sind die Kartographen nunmehr
in der Lage, exakte geodätische Vermessungen vorzunehmen, verläßliche
Daten über die Oberfläche der Erde zu erhalten, diese in
Relation zu bereits vorhandenen Erkentnissen zu stellen und in Form
von Karten abzubilden. Durch die hier in Kürze nachskizzierte
Entwicklung aus dem Mittelalter, aus der Umklammerung durch christliche
Weltvorstellungen heraus, kommt man zu einer Orientierung an beobachtbaren,
meßbaren Phänomenen der physischen Welt, die von einer
Perfektionierung der Aufnahme- und Abbildungsinstrumentarien vorangetrieben
werden und somit entstehen neue Möglichkeiten der Weltbeschreibung.
Man versucht anfangs noch ein Weltbild zur Anschauung zu bringen und
ordnet sämtliche Forschungsergebnisse den ideologischen Deutungen
unter. Dabei kann man auch getrost auf die Weiterentwicklung der Meßapparaturen
verzichten und sich auf die ästhetische Qualitäten der Abbildungen
konzentrieren. Am Beispiel des Bildes "Der wunderbare Fischzug" wird
, in einer Art Vorgriff, das Streben nach objektiver, ideologisch
unverstellter Anschauung der realen Welt deutlich. Der weitere Weg
wird anhand der Entwicklung des Kartenwesens anschaulich. Mit den
Vermessungen der See- und Landgebiete stösst man bald an technische
Grenzen, da die tatsächlichen Relationen zueinander und der jeweilige
Standort des Beobachters nur ungenau zu bestimmen sind. Daher ist
es notwendig geworden, unter anderem auch einen externen Bezugspunkt
zu finden, der als eine Art allgemein verbindlicher, 'perspektivischer
Fluchtpunkt' dienen kann. Dazu verlässt man den Beobachtungsgegenstand
'Erde' und beginnt sich an den Gestirnen zu orientieren, bzw. an allgemein
verbindlichen, abstrakten Unterteilungen (Zeiteinheiten, Gradeinteilung,
usw.). Mit den neu entwickelten Apparaturen, der größeren
Meßgenauigkeit und den externen, abstrakten Bezugsfeldern, wird
gleichzeitig die Frage der Darstellbarkeit neu formuliert. Die Darstellung
steht nun nicht länger im Dienste einer Weltanschauung, sondern
über die Verbildlichung von Daten und Ergebnissen der Wissenschaft
wandelt sich das Bild der Welt in unseren Köpfen. Man gewöhnt
sich an den Gebrauch der Apparate und an die Notwendigkeit des Blickes
durch sie hindurch, von unten nach oben und von dort, über die
Abstraktion der Mathematik wieder auf die Welt. Es ist buchstäblich
notwendig geworden den Boden der Tatsachen zu verlassen, um ihn in
seiner neuen Komplexität erfassen zu können. Aeronautik
Am 21.11 1783 steigt in Paris zum ersten Mal der Ballon der Gebrüder
Montgolfier in den Himmel auf und eröffnet den Pionieren einen
vollkommen neuen Blick auf ihre Umgebung. Von oben betrachtet erinnert
die Ansicht der Erdoberfläche, dem Städteraster und Wegenetzen,
den Parzellen aus Feldern, Wäldern, an den Blick auf eine gezeichnete
Landkarte. Die Ansicht wird ihnen plötzlich zur Ü bersicht
und es ergeben sich neue Muster der direkten Anschauung, wie sie bisher
nur in der zeitlich gedehnten, gestückelten Betrachtung des Landvermessers
und der des Kartographen angedeutet war. Der Blick auf eine "reale
Karte", verwirrt die gerade erst gewonnene zentralperspektivische
Sicht auf die Welt. Was zuvor über die zeitlich gedehnte Vermessung
einzelner Abschnitte, das Fixieren einzelner Daten erst zu einem Geamtbild
gefügt wurde, eröffnet sich nun dem menschlichen Auge in
verwirrender Gleichzeitigkeit. Nun verläßt der  Betrachter
zum ersten Mal den Betrachtungsgegenstand, begibt sich in einen scheinbar
neutralen, überschauenden Abstand, um zu einer objektiven Sicht
der Dinge zu kommen. Doch wird es jetzt auch zunehmend schwierig das
Auge an einen einzigen Fixpunkt zu heften. Photographie Der Versuch
auf Blidern das wiederzugeben was das Auge sieht wird gegen Ende des
18. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Photographie weiter vorangetrieben.
Relativ schnell entwickelt sie sich, nach Ü berwindung einiger
technischer Hindernisse, zu einem Verfahren das begierig von vielen
aufgenommen wird, da sie die augenmäßig 'richtige' Perspektive
automatisch erzeugt. Durch die Photo-Optik stellt sich die Zentral-,
Farb- und Luftperspektive gleichsam von selbst ein. Es ist einer der
renommiertesten Photographen Felix Gaspard Tournachon, genannt Nadar,
der um 1850 diese neue Möglichkeit der Perspektivierung erkennt
und konsequent umsetzt. Während sein Interesse weniger den technischen
Möglichkeiten des neuen Mediums gilt, konzentriert er sich besonders
auf außergewöhnliche Aufnahmesituationen. Parallel zu seinen
Experimenten mit elektrischem Licht, um Bilder in den Katakomben von
Paris zu machen, widmet er sich leidenschaftlich der Ballonfahrt.
1857 unternimmt er seinen ersten Flug in der Absicht Photos aus der
Luft aufzunehemen. Das gelingt ihm aber erst ein Jahr später,
nachdem er die Schwierigkeit, daß das aus dem Ballon austretende
Gas die Negative verdirbt, überwindet. Gleich danach meldet er
sein Patent auf aerostatische Photographien an. Mit seinen bis dahin
beispiellosen Aufnahmen und seinem damals mit einem Umfang von 45
Metern größten Fesselballon "Gé ant" gelangt Nadar
zu weltweiter Anerkennung. Aber noch eine weitere Besonderheit der
photographischen Technik ist hier von Bedeutung. Neben der Schärfe
und der Perspektive, ist die Möglichkeit entstanden, das Flüchtige
zu fixieren und damit dem Augenblick Dauer zu verleihen. Im Bruchteil
einer Sekunde läßt sich vollenden, wofür man vorher
Stunden und Tage benötigte. In diesen immer kleiner werdenden
Zeiteinheiten vollziehen sich Ereignisse, von denen wir uns ohne den
photographischen Prozeß, kaum auch nur eine vage Vorstellung
machen könnten. Die neue Technik ermöglicht so nicht nur
eine Rationalisierung des Abbildens, sondern eröffnet auch zunehmend
den Blick in den Mikrokosmos der Zeit. Kosmische Strahlen Einige Jahre
später, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ergibt sich für
die Forschung im Bereich der Physik ein verblüffendes Ergebnis.
Es kursiert, neben anderen Theorien, bei einigen Physikern die Vermutung,
die Erde werde aus dem Weltall mit Teilchen beschossen, die auf ihrem
Weg zur Erde die Luft elektrisch aufladen. Der österreichische
Physiker Victor F. Hess beschäftigt sich ebenfalls mit Untersuchungen
in diesem Bereich und steigt 1912 mit einem Ballon auf, um die Leitfähigkeit
der Luft in höheren Regionen zu testen. Sein Ansatz bestätigt
sich und er kann nachweisen, daß Luft in großer Höhe
tatsächlich besser leitet als am Boden, was letztlich die Weltraumstrahlen-Hypothese
stützt. In der Folge spricht man nun von "kosmischen Strahlen"
oder "kosmischen Teilchen". Bis dahin beruhen alle Untersuchungen
der kosmischen Strahlen auf Messungen der Leitfähigkeit der Luft.
Über das Verhalten der kosmischen Teilchen im speziellen ist
dem allerdings wenig zu entnehmen. Neben der Nebelkammer, in der Teilchenspuren
als feine Kondensstreifen sichtbar werden, führt vor allem die
Entwicklung der photographischen Emulsion, die die Flugbahn der Teilchen
die sie durchquert, in Form kettenartiger Spuren aus winzigen Silberkörnchen
festhält, zu wichtigen neuen Entdeckungen. Elektronische Zähler,
die Nebelkammer und die photographische Emulsion sind von den zwanziger
bis zum Beginn der sechziger Jahre die wichtigsten Werkzeuge der Teilchenphysik.
Rundgang 3 Am Ende dieses assosiativen Ausfluges zu exemplarischen
Momenten, die Einfluss darauf haben wie wir heute die Welt wahrnehmen
und uns in ihr orientieren, sind wir wieder am CERN angekommen. Hier
wird nun der dritte Teil unserer Reise in die Umgebung von Genf seinen
Ausgang nehmen. Bereits am Morgen verlassen wir die zentralen Anlagen
des CERN bei Meyrin, überqueren nach wenigen Metern die Grenze
nach Frankreich und folgen der Hauptstrasse nach St.-Genis-Pouilly.
Vorbei am Centre culturel, verlassen wir die geteerten Wege und wandern
querfeldein auf einige unscheinbare Flachbauten aus Beton zu - der
einzig sichtbare Hinweis auf den ersten Detektor. Wir lassen ihn linkerhand
zurück und setzen den Fussmarsch fort, über Felder, Wiesen,
vorbei an Bauernhöfen, durch kleine Waldstücke hindurch,
passieren Chevry, Naz-dessous und nähern uns dem Dorf Echenevex.
Wieder sind wir an einer Detektoranlage vorrübergegangen, bevor
wir uns bei La Table Ronde Richtung Westen wenden.
Betrachter
zum ersten Mal den Betrachtungsgegenstand, begibt sich in einen scheinbar
neutralen, überschauenden Abstand, um zu einer objektiven Sicht
der Dinge zu kommen. Doch wird es jetzt auch zunehmend schwierig das
Auge an einen einzigen Fixpunkt zu heften. Photographie Der Versuch
auf Blidern das wiederzugeben was das Auge sieht wird gegen Ende des
18. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Photographie weiter vorangetrieben.
Relativ schnell entwickelt sie sich, nach Ü berwindung einiger
technischer Hindernisse, zu einem Verfahren das begierig von vielen
aufgenommen wird, da sie die augenmäßig 'richtige' Perspektive
automatisch erzeugt. Durch die Photo-Optik stellt sich die Zentral-,
Farb- und Luftperspektive gleichsam von selbst ein. Es ist einer der
renommiertesten Photographen Felix Gaspard Tournachon, genannt Nadar,
der um 1850 diese neue Möglichkeit der Perspektivierung erkennt
und konsequent umsetzt. Während sein Interesse weniger den technischen
Möglichkeiten des neuen Mediums gilt, konzentriert er sich besonders
auf außergewöhnliche Aufnahmesituationen. Parallel zu seinen
Experimenten mit elektrischem Licht, um Bilder in den Katakomben von
Paris zu machen, widmet er sich leidenschaftlich der Ballonfahrt.
1857 unternimmt er seinen ersten Flug in der Absicht Photos aus der
Luft aufzunehemen. Das gelingt ihm aber erst ein Jahr später,
nachdem er die Schwierigkeit, daß das aus dem Ballon austretende
Gas die Negative verdirbt, überwindet. Gleich danach meldet er
sein Patent auf aerostatische Photographien an. Mit seinen bis dahin
beispiellosen Aufnahmen und seinem damals mit einem Umfang von 45
Metern größten Fesselballon "Gé ant" gelangt Nadar
zu weltweiter Anerkennung. Aber noch eine weitere Besonderheit der
photographischen Technik ist hier von Bedeutung. Neben der Schärfe
und der Perspektive, ist die Möglichkeit entstanden, das Flüchtige
zu fixieren und damit dem Augenblick Dauer zu verleihen. Im Bruchteil
einer Sekunde läßt sich vollenden, wofür man vorher
Stunden und Tage benötigte. In diesen immer kleiner werdenden
Zeiteinheiten vollziehen sich Ereignisse, von denen wir uns ohne den
photographischen Prozeß, kaum auch nur eine vage Vorstellung
machen könnten. Die neue Technik ermöglicht so nicht nur
eine Rationalisierung des Abbildens, sondern eröffnet auch zunehmend
den Blick in den Mikrokosmos der Zeit. Kosmische Strahlen Einige Jahre
später, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ergibt sich für
die Forschung im Bereich der Physik ein verblüffendes Ergebnis.
Es kursiert, neben anderen Theorien, bei einigen Physikern die Vermutung,
die Erde werde aus dem Weltall mit Teilchen beschossen, die auf ihrem
Weg zur Erde die Luft elektrisch aufladen. Der österreichische
Physiker Victor F. Hess beschäftigt sich ebenfalls mit Untersuchungen
in diesem Bereich und steigt 1912 mit einem Ballon auf, um die Leitfähigkeit
der Luft in höheren Regionen zu testen. Sein Ansatz bestätigt
sich und er kann nachweisen, daß Luft in großer Höhe
tatsächlich besser leitet als am Boden, was letztlich die Weltraumstrahlen-Hypothese
stützt. In der Folge spricht man nun von "kosmischen Strahlen"
oder "kosmischen Teilchen". Bis dahin beruhen alle Untersuchungen
der kosmischen Strahlen auf Messungen der Leitfähigkeit der Luft.
Über das Verhalten der kosmischen Teilchen im speziellen ist
dem allerdings wenig zu entnehmen. Neben der Nebelkammer, in der Teilchenspuren
als feine Kondensstreifen sichtbar werden, führt vor allem die
Entwicklung der photographischen Emulsion, die die Flugbahn der Teilchen
die sie durchquert, in Form kettenartiger Spuren aus winzigen Silberkörnchen
festhält, zu wichtigen neuen Entdeckungen. Elektronische Zähler,
die Nebelkammer und die photographische Emulsion sind von den zwanziger
bis zum Beginn der sechziger Jahre die wichtigsten Werkzeuge der Teilchenphysik.
Rundgang 3 Am Ende dieses assosiativen Ausfluges zu exemplarischen
Momenten, die Einfluss darauf haben wie wir heute die Welt wahrnehmen
und uns in ihr orientieren, sind wir wieder am CERN angekommen. Hier
wird nun der dritte Teil unserer Reise in die Umgebung von Genf seinen
Ausgang nehmen. Bereits am Morgen verlassen wir die zentralen Anlagen
des CERN bei Meyrin, überqueren nach wenigen Metern die Grenze
nach Frankreich und folgen der Hauptstrasse nach St.-Genis-Pouilly.
Vorbei am Centre culturel, verlassen wir die geteerten Wege und wandern
querfeldein auf einige unscheinbare Flachbauten aus Beton zu - der
einzig sichtbare Hinweis auf den ersten Detektor. Wir lassen ihn linkerhand
zurück und setzen den Fussmarsch fort, über Felder, Wiesen,
vorbei an Bauernhöfen, durch kleine Waldstücke hindurch,
passieren Chevry, Naz-dessous und nähern uns dem Dorf Echenevex.
Wieder sind wir an einer Detektoranlage vorrübergegangen, bevor
wir uns bei La Table Ronde Richtung Westen wenden.  Nach
einiger Zeit entdecken wir auf freiem Feld erneut zwei unscheinbare
Betonbauten des CERN. Von da an orientieren wir uns auf Versonnex
zu und durchqueren wenig später die Ortschaft auf einigen Nebenstrassen.
Ein Stück weiter im Westen, kurz hinter den ausgedehnten modernen
Wohnsiedlungen von Le Bois Chatton, im Grunde mitten auf der französisch-schweizerischen
Grenze, finden wir im Wald versteckt die nächsten Anzeichen auf
einen der Detektoren. Danach überqueren wir die grüne Grenze
zur Schweiz, machen einen Bogen über Bossy und Collex, um im
Norden von Ferney-Voltaire wieder nach Frankreich zu wechseln. In
der Abenddämmerung laufen wir durch die Kleinstadt und halten
uns auf der Hauptstrasse in Richtung Meyrin. Zum letzten Mal überschreiten
wir die Grenze, durchqueren dann den Vorort Les Vernes bis wir im
Zentrum des Schweizer Ortes Meyrin ankommen. Von hier ist es nurmehr
einen Kilometer bis zu unserem Ausgangspunkt zurück, den wir
bei einsetzender Dunkelheit erreichen. Wir sind dem unterirdischen
Verlauf der Beschleunigerringe gefolgt, in dem Gebiet zwischen Juragebirge
und Genfer See. Dabei haben wir uns anhand von Flurkarten und der
bereits erwähnten Standard-Postkarte aus dem CERN-Souvenirladen
orientiert, die eine Luftaufnahme der gesamten Anlage zeigt. Die Spur
dieser Wanderung resultiert in einer Art Landkarte, die an die Markierung
eines klassischen Territoriums erinnert. Zeichnen wir den gesamten
Weg auf Video auf, lassen sich diese Bilder als eine Art 'zeitliches
Panoramabild' des Forschungskomplexes betrachten. Dies jedoch nicht
in Bezug auf seine außergewöhnlichen technischen Instrumentarien,
mit deren Hilfe ein im Detail immer genaueres Bild der Welt und des
Universums entwickelt werden soll. Vielmehr gilt hier das Interesse
der Form des Instrumentes mit dem an diesem Weltbild gearbeitet wird,
in seinen geographischen, sozialen, historischen, politischen und
wahrnehmungsspezifischen Aspekten.
Nach
einiger Zeit entdecken wir auf freiem Feld erneut zwei unscheinbare
Betonbauten des CERN. Von da an orientieren wir uns auf Versonnex
zu und durchqueren wenig später die Ortschaft auf einigen Nebenstrassen.
Ein Stück weiter im Westen, kurz hinter den ausgedehnten modernen
Wohnsiedlungen von Le Bois Chatton, im Grunde mitten auf der französisch-schweizerischen
Grenze, finden wir im Wald versteckt die nächsten Anzeichen auf
einen der Detektoren. Danach überqueren wir die grüne Grenze
zur Schweiz, machen einen Bogen über Bossy und Collex, um im
Norden von Ferney-Voltaire wieder nach Frankreich zu wechseln. In
der Abenddämmerung laufen wir durch die Kleinstadt und halten
uns auf der Hauptstrasse in Richtung Meyrin. Zum letzten Mal überschreiten
wir die Grenze, durchqueren dann den Vorort Les Vernes bis wir im
Zentrum des Schweizer Ortes Meyrin ankommen. Von hier ist es nurmehr
einen Kilometer bis zu unserem Ausgangspunkt zurück, den wir
bei einsetzender Dunkelheit erreichen. Wir sind dem unterirdischen
Verlauf der Beschleunigerringe gefolgt, in dem Gebiet zwischen Juragebirge
und Genfer See. Dabei haben wir uns anhand von Flurkarten und der
bereits erwähnten Standard-Postkarte aus dem CERN-Souvenirladen
orientiert, die eine Luftaufnahme der gesamten Anlage zeigt. Die Spur
dieser Wanderung resultiert in einer Art Landkarte, die an die Markierung
eines klassischen Territoriums erinnert. Zeichnen wir den gesamten
Weg auf Video auf, lassen sich diese Bilder als eine Art 'zeitliches
Panoramabild' des Forschungskomplexes betrachten. Dies jedoch nicht
in Bezug auf seine außergewöhnlichen technischen Instrumentarien,
mit deren Hilfe ein im Detail immer genaueres Bild der Welt und des
Universums entwickelt werden soll. Vielmehr gilt hier das Interesse
der Form des Instrumentes mit dem an diesem Weltbild gearbeitet wird,
in seinen geographischen, sozialen, historischen, politischen und
wahrnehmungsspezifischen Aspekten.