AUF DER SUCHE NACH DEM UNSICHTBAREN BöSEN
Dr. Ulrike Sprenger über den Fall Zurwehme
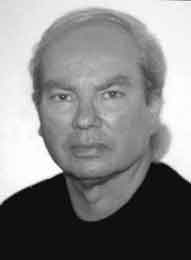 |
Dieter Zurwehme |
Kluge (K) Ein besonderer Fall. Entnervte Fahnder, umstellte Felder, eine Festnahme. Hundertschaften haben versucht, ihn zu finden, zwei einfache Streifenbeamte, unbewaffnet, fassen ihn. Was für ein Fall?
Sprenger (S) Das ist der Fall von Dieter Zurwehme, der ja über die Frühjahr- und Sommermonate hinweg in der Presse ganz stark präsent war und diskutiert wurde und den man – auch wenn man sich für diesen Fall nicht interessiert hat – ständig mitverfolgen musste. Das ging soweit, dass tatsächlich das ganze Land irgendwie Angst hatte und man ihn überall gesehen haben wollte. Zum Schluss scheiterte die Fahndung nicht zuletzt an der Vielzahl der Hinweise aus der Bevölkerung, nicht an einem Mangel an Hinweisen, sondern weil jeder Zurwehme irgendwo gesehen haben wollte. Und jeder dieser Hinweise hätte stimmen können oder hätte falsch sein können.
(K) über die ursprüngliche Verurteilung, warum er 1974 ins Gefängnis kam, gibt es eigentlich keine Informationen in den Medien.
(S) Darüber wird überhaupt nie berichtet, und deshalb, glaube ich, muss über diesen Fall überhaupt in dieser Weise gesprochen werden, weil er die Frage nach dem Sinn von Verfolgung und Flucht aufwirft und weil er sich von vorneherein nur in diesen Kreisen von Verfolgung und Flucht bewegt. Man nennt ihn den Mörder von Remagen, aber die ursprüngliche Tat, wegen der man ihn als Mörder bezeichnet, wegen der er 24 Jahre im Gefängnis saß und 24 Jahre nicht von sich reden machte, die ist überhaupt keiner Rede wert. Sie wird in den Medien immer nur als die Tat bezeichnet, wegen der er im Fernsehen war. Man erfährt nicht, ob es zum Beispiel ein Doppelmord war, ob sie also eine ähnlichkeit aufwies, die dann später die Leute beschäftigte. Das heißt, die Tat, wegen der man ihn sucht, ist von vornherein schon eine Tat, mit der diese Suche vereitelt werden soll. Der Mann bewegt sich von Anfang an in diesem Spannungsfeld von Verstecken und Suchen, um nicht gefunden zu werden, und ungeheurem technischen Aufwand, um dann schließlich ohne diesen Aufwand doch gefunden zu werden.
(K) Wobei der technische Aufwand ins Leere geht und eine Reihe von zusätzlichem Unheil schafft. Und wir reden die ganze Zeit davon. Welche Aufmerksamkeit haben Medien, welche Aufmerksamkeit haben diese vielen Menschen, die diese Medien nutzen?
(S) Die Aufmerksamkeit entsteht erst dann, wenn ein nicht gelöster Konflikt in diesem Fall zum Vorschein kommt. Wenn zum Beispiel die Frage aufgeworfen wird: Wie ist das, wenn durch Verfolgung Verbrechen entstehen? Oder wenn Verbrechen aus Angst vor Verfolgung entstehen?
(K) Ist das ein Mensch, der zu uns gehört, oder ist das ein Ausgestoßener, der einfach zu einer Menschheit gehört, die böse ist?
 (S)
Man kann natürlich nicht sagen, die Verbrechen von Zurwehme sind durch
die Verfolgung entstanden. Genauso wenig kann man aber sagen, sie
sind nicht dadurch entstanden. Was die öffentlichkeit beschäftigt
und was die Angst auslöst und die Unsicherheit, die diese ganze Berichterstattung
begleitet, ist eben die Frage: Ist er das Böse schlechthin, ist er
ein Nicht-Zähmbarer, ein Nicht-Integrierbarer, ein geborener Mörder?
Oder ist er jemand, der aus dem Gefängnis auftaucht wie aus dem Nichts,
wie Schillers »Verbrecher aus verlorener Ehre«, und der dann sozusagen
seinem Ruf hinterhereilt, der sich also dann mit den Taten identifiziert,
die man ihm zuschreibt. Diese Frage ist einfach nicht klärbar, und
diese Frage schwingt im Hintergrund mit, bei jeder Berichterstattung.
Und deswegen ist für die Presse und die Medien auch die ursprüngliche
Tat uninteressant. Bei dieser Tat wirft sich keine Frage auf, offenbar
hat sich auch damals keine Frage aufgeworfen, es war eine Tat, für
die er verurteilt und ins Gefängnis geschafft wurde. Und diese Frage
ist keine Diskussion mehr wert.
(S)
Man kann natürlich nicht sagen, die Verbrechen von Zurwehme sind durch
die Verfolgung entstanden. Genauso wenig kann man aber sagen, sie
sind nicht dadurch entstanden. Was die öffentlichkeit beschäftigt
und was die Angst auslöst und die Unsicherheit, die diese ganze Berichterstattung
begleitet, ist eben die Frage: Ist er das Böse schlechthin, ist er
ein Nicht-Zähmbarer, ein Nicht-Integrierbarer, ein geborener Mörder?
Oder ist er jemand, der aus dem Gefängnis auftaucht wie aus dem Nichts,
wie Schillers »Verbrecher aus verlorener Ehre«, und der dann sozusagen
seinem Ruf hinterhereilt, der sich also dann mit den Taten identifiziert,
die man ihm zuschreibt. Diese Frage ist einfach nicht klärbar, und
diese Frage schwingt im Hintergrund mit, bei jeder Berichterstattung.
Und deswegen ist für die Presse und die Medien auch die ursprüngliche
Tat uninteressant. Bei dieser Tat wirft sich keine Frage auf, offenbar
hat sich auch damals keine Frage aufgeworfen, es war eine Tat, für
die er verurteilt und ins Gefängnis geschafft wurde. Und diese Frage
ist keine Diskussion mehr wert.
Als er zum Schluss gestellt wird, wird er auf der Straße von einem im Auto Vorüberfahrenden erkannt. Der fährt nochmal zurück, um sich zu überzeugen, ob das Gesicht dem Fahndungsfoto entspricht. Dann geht er zur Polizei und sagt: Kommen Sie mit. In wenigen Minuten sind zwei Beamte bereit, die setzen sich zu diesem Touristen ins Auto, und dann fahren sie nochmal vorbei, und der Zeuge sagt: Nun schauen Sie sich den mal genau an.
(K) Wäre ein Sonderkommando benachrichtigt worden, hätte man ihn nicht mehr gekriegt.
(S) Es war auch gar keine Zeit. Die beiden Beamten steigen aus und sind auch selber nicht sicher, was da passiert. Sie sind unbewaffnet und nehmen eine sogenannte Personenkontrolle vor, die sie jederzeit vornehmen dürfen.
(K) Er hatte ein Messer bei sich.
(S) Ein Klappmesser und eine Gaspistole.
(K) Er hätte sie bedrohen können.
(S) Ja. Das Ganze hätte noch einen völlig anderen Ausgang nehmen können. Das Interessante an dieser Stelle ist das Mißverhältnis zwischen der monatelangen Fahndung, die mit höchstem Aufwand und personellem Einsatz betrieben wird, wo man Maisfelder durchkämmt, Halm für Halm, wo man ganze Wälder einkesselt und ihn sucht, und der Festnahme dann durch zwei unbewaffnete Polizisten auf offener Straße an einem schönen Sommertag.
(K) Und er antwortet auf die Fragen der Beamten.
(S) Auf die Aufforderung der Beamten, er solle sich ausweisen und seinen Pass herzeigen, antwortet er, er habe keinen Pass, aber er sei der, den sie suchen. Und das ist ein Satz, wo dieser mutmaßliche Mörder im Grunde über sich hinauswächst, denn aus diesem Wort spricht nicht nur er selbst als Person, sondern da spricht diese ganze Suche, die zu ihm geführt hat: Ich bin der, den Sie suchen. Denn da liegt eine unglaubliche Selbstdistanz drin. Wenn er von sich selbst sagt, ich kann mich nicht ausweisen, aber ich bin der, den ihr sucht, ich gebe mich zu erkennen, ich bin der, für den ihr mich haltet, dann nimmt er in diesem Augenblick die Perspektive der Polizisten ein und bestätigt ihnen das, was sie denken. Indem er sagt, ich bin der, den ihr sucht, sagt er zugleich, ich bin der, der diese Taten, von denen ihr meint, dass ich sie begangen habe, auf sich nimmt. Also ich bin der, der sich jetzt in diesem Augenblick mit dem Bild, das ihr von mir habt, identifiziert.
(K) Im Dezember 1998 ist es besonders kalt. Zu diesem Zeitpunkt kehrt er von einem Freigang in sein Gefängnis nicht zurück. Das ist der Anfang.
(S) Ja, das ist der Anfang seiner Wanderung. Und er wird dann gefasst im Sommer, als eigentlich die Bedingungen fast ideal scheinen, nie entdeckt zu werden. Er kann im Freien schlafen, es ist warm …
(K) … hohes Korn, um sich zu verstecken.
(S) Er hat die perfekte Tarnung des Touristen und Wanderers, auch das ermöglicht ihm ja nur die Jahreszeit.
(K) Im Mittelalter oder bei Schiller ist ein Wanderer jemand, der Misstrauen auslöst, ein Fremder. Wessen Aufenthalt an diesem Ort unwahrscheinlich ist, der ist verdächtig. Heute würden wir sagen, jemand, der zu dem Ort, an dem er sich befindet, nicht passt, das ist ein Tourist – die ideale Tarnung.
 |
Der 68jährige Wanderer Friedhelm B. wird von zwei Polizeibeamten durch die geschlossene Türe hindurch erschossen. |
(S) Ja. Und interessant ist auch die gespaltene Reaktion der öffentlichkeit auf das Erscheinungsbild von Zurwehme in dem Augenblick, in dem er festgenommen wird, denn er ist gebräunt und sieht erholt aus, er sieht eigentlich gut aus. Er wirkt zwar müde von der Flucht, aber er sieht eben aus wie ein Wanderer oder ein Tourist. Und es schwingt in allen Artikeln, die von der Festnahme berichten, eine gewisse Empörung mit: Wie kann ein Verbrecher, ein Mörder, aussehen wie ein gerade von Ibiza oder Mallorca zurückgekehrter Tourist? Diese zwiespältige Reaktion der öffentlichkeit auf diese Bräune im Gesicht spiegelt im Grunde nur das wieder, was wir aus dem Mittelalter oder der frühen Neuzeit noch kennen: nämlich einerseits das Bild des braven Touristen, der kein Mörder sein darf und sein kann, und andererseits das Bild des Fahrenden, der suspekt ist, also der nicht sesshaft ist, der nicht blass ist, wie es sich gehört, sondern der im Freien, in den Wäldern lebt und der mit der Natur vertraut ist.
(K) Hat er ein Fahrrad?
(S) Er hat zwischendurch auch einmal ein Fahrrad gestohlen, er bewegt sich aber meistens zu Fuß fort, also richtig wie ein Wanderer, und es wird ja auch ein Wanderer statt seiner erschossen, ein wandernder Rentner wird in Thüringen mit ihm verwechselt.
(K) Und sie erschießen diesen Wanderer durch die Tür hindurch. Sie waren sicher, dass es Zurwehme ist.
(S) Durch die halbgeschlossene Tür – eine Szene, wie man sie sich im Grunde eigentlich nur für den Heimatfilm vorstellen kann, oder auch für Tragödien, in denen Väter aus Versehen ihre Kinder erschießen, weil sie sie für Verbrecher oder für die Usurpatoren in der Ehe halten. Das kommt in den Dramen des 18. Jahrhunderts vor, dass die Verwechslung zum Tod eines Unschuldigen führt. Und genau diesem Schema folgt die Geschichte, die über Zurwehme erzählt wird. Und die Frage nach seiner Identität, wer ist das, hat die öffentlichkeit so gefesselt, hat auch die Polizisten so in ihren Bann gezogen, dass sie gar nicht mehr wagten zu sehen, wer das ist: Einfach aufgrund der Geschichte, die die Kellnerin, die sie im Rundfunk gehört hat, ihnen wiedererzählt, indem sie sagt: Dieser Mann, der bei uns abgestiegen ist, passt auf die Geschichte, die ich im Radio gehört habe. … und dieser Schuss durch die geschlossene Tür ist eben genau der Schuss nach dem unsichtbaren Bösen, das man aufgrund der Geschichte, die einem erzählt wird, so präsent hat, dass es in dem Augenblick auch da ist und dass man darauf schießt. Die Frage, wie das passieren konnte, ist ja in der öffentlichkeit breit diskutiert worden. Wie können ausgebildete Polizisten jemanden durch eine fast geschlossene Tür erschießen, bevor sie gesehen haben, wer er ist, und bevor sie überprüft haben, ob dieser Wanderer tatsächlich Zurwehme ist. Und das ist nur erklärbar durch diese Omnipräsenz der Geschichte, das heißt durch die Omnipräsenz der Person Zurwehme in ganz Deutschland, die dadurch suggeriert wird, dass man ihn überall vermuten und überall sehen kann.
(K) Und diese Geschichten und ihre Dramaturgie sind etwas, was vor 300 oder 400 Jahren, eigentlich gleichzeitig mit dem Aufschreiben der Märchen und mit der Entstehung der deutschen Literatur entsteht – und übrigens in den anderen europäischen Ländern so ähnlich entstanden ist – und heute eine Realität bildet, so dass man sagen kann: Wenn die Realität Geschichten erzählt, Fiction macht, dann ist das der Grund, dass hier Geschichten fortwirken, die sehr alt sind.
(S) Ja, hier wirken Geschichten fort, die sehr alt sind, hier wirkt die Frage fort, wie sieht das Böse aus und wo hält es sich auf? Das sind die Fragen, die dem zugrunde liegen. Wie erkenne ich das Böse? Und da haben eben verschiedene Zeiten immer verschiedene Antworten drauf gefunden, aber die Frage ist letztendlich nicht gelöst.
(K) Immer wenn ein Zwiespalt in diesen Antworten steckt, wo eine moralische Innovation stattfindet, ein Niemandsland zwischen zwei moralischen Ländern entsteht, dann entsteht eine öffentliche Aufmerksamkeit besonderer Art, der sich Menschen nicht entziehen können.
(S) Das wäre in diesem Fall eben genau die Frage, weswegen uns auch der ursprüngliche Mord nie als Thema präsentiert wird. Der war klar, da war auch die Frage nach der Schuld klar, und was mitschwingt in der Berichterstattung jetzt, ist eben genau diese offene Frage, dieser ungelöste moralische Konflikt: Was erzeugt das Verbrechen? Eine Eigenschaft des Mörders, eine Eigenschaft desjenigen, den man einen Mörder nennt?
(K) Hat der Mörder reagiert, oder wollte er etwas haben, wenn er doch offenkundig von dem Mord, der grausam ist, nichts hat? Er ist grausam genug, sich Geld zu beschaffen durch überfälle. Er könnte im Grunde wie ein Räuber …
(S) … wie ein unauffälliger Räuber könnte er leben. Aber was macht er? Er vergewaltigt, er verhält sich …
(K) … er sorgt dafür, dass eine Spur gelegt bleibt.
(S) Ja. Und man fragt sich – abgesehen natürlich von dem Leid, das er dadurch erzeugt –, warum tut er das? Er hätte doch jetzt sogar noch die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Also die Identifikation mit dem Verbrecher, die solche Geschichten immer erzeugen, lässt diese Frage ja auch aufkommen. Jetzt hätte er doch die Chance.
(K) Dabei sprechen wir jetzt immer von Medien und Aufmerksamkeiten, die auf die Medien antworten. Alles, was wir zu Zurwehme sagen, ist mutmaßlich.
 |
»Die Diskrepanz zwischen dem Bild und dem Sprechen hat auch bei Zurwehme und der Medienberichterstattung eine große Rolle gespielt. Wir haben ja nur dieses Fahndungsfoto, dieses Bild von Zurwehme gekannt, auf dem dieser etwas dickliche Mensch so präsentiert wird, dass wir sofort unsere Vorstellung von einem Verbrecher damit zur Deckung bringen konnten. Dazu im Gegensatz steht der Bericht des Försters, dem Zurwehme im Wald begegnet und der sich wundert, wie höflich und wohlartikuliert er sich mit ihm unterhalten habe. … der hat ihn erst hinterher erkannt und diese Verzögerung im Erkennen ist eben genau diese Diskrepanz zwischen Wort und Bild. Während Zurwehme spricht, kann das Bild ja überhaupt nicht fassen, dieses stumme Fahndungsfoto. Erst in dem Augenblick, wo der Förster ihn nicht mehr vor sich hat, ihn nicht mehr sprechen hört, kann er plötzlich das, was er gesehen hat, mit dem Fahndungsfoto zur Deckung bringen. …« |
(S) … ist mutmaßlich, wir kennen ihn ja nicht, er wird uns ja nur so präsentiert. Und so, wie die Medien ihn uns präsentieren, fragen wir uns, warum hört er jetzt nicht auf, warum macht er sich nicht ein bequemes Leben mit einer neuen Identität als wandernder Kleinkrimineller, und genau das findet nicht statt. Und da sehen wir eben dann diesen offenen Konflikt, der dann auch die öffentlichkeit bewegt. Offenbar greift hier irgendein Mechanismus, mit dem er sich als Ausgestoßener kennzeichnet. Das heißt, der Weitermordende, der Weitervergewaltigende ist einer, der nicht von der Gesellschaft lassen kann, er ist einer der zurückkehren will in irgendeiner Form und der deswegen auch diese Spur legt. Er will sich mit seinen Taten identisch machen.
(K) Er will den Fußabdruck seiner Taten füllen.
(S) Ja.
(K) Das heißt, er ringt im Grunde darum, dass die Gesellschaft ihn sieht …
(S) … und dass das Bild, das die Gesellschaft sich von ihm macht, in irgendeiner Weise mit seiner Person zur Deckung kommt. Und auch, dass die Strafe dann letztlich stimmt, die man ihm auferlegt.
(K) Und die Verheimlichung und das Unsichtbarwerden, sind gar nicht sein Interesse. Mutmaßlich.
(S) Ja, das weiss man nicht. Das kann natürlich auch die andere Lösung sein, die da immer mitschwingt und die uns auch immer miterzählt wird.
(K) Aber alle Geschichten, die wir aus dieser Dramaturgie kennen, die da vor 400 Jahren, vor dem Dreißigjährigen Krieg, im Dreißigjährigen Krieg, danach, in den Bauernkriegen, ausgekocht wird in unserer deutschen Sprache, beruhen darauf, dass dieses Mutmaßliche tatsächlich eine Zeichensetzung enthält, nach der Menschen sich verhalten. Und zwar die polizeilichen Verfolger genauso wie der Verfolgte.
(S) Ja, und dass das letztlich nie gelöst worden ist. Dass wir nicht erkennen können, wo das Böse sitzt und wodurch es erzeugt wird. Und dass wir uns an dieser Frage einfach abarbeiten und dass eine Geschichte eben immer als verschiedene Geschichten erzählt werden kann. Also die Geschichte des Mörders Zurwehme, der ein Mörder war und ein Mörder bleibt und immer ein Mörder ist. Oder die Geschichte des Mörders Zurwehme, der plötzlich ein anderer Mörder wird, der jemand wird, der zum Mord getrieben wird aufgrund der Suche, die man nach ihm lanciert. Aufgrund der Suche, die offenbar das Grässlichste für ihn darstellt, was er sich vorstellen kann. Oder ein Mörder Zurwehme, der ins Gefängnis zurückkehren möchte, um wieder mit sich eins zu sein und deswegen die Tat wiederholt.
(K) Und nun gibt es eine kriminelle Gegenwelt, die einfach böse ist und nicht in unser Gemeinwesen gehört, die aber müde geworden ist und einfach die Verfolgung satt hat und wieder zurückkehren will. Das aber im Sommer, wo es gar nicht kalt ist, er musste eigentlich gar nicht nach Hause ins Gefängnis.
(S) Ja. Und das ist eines der erschreckensten Bilder, weil da natürlich die Frage nach der Moral überhaupt keinen Griff mehr hat. Was ist so einer für ein Mensch, der in einer Welt lebt, in der die Moral nicht zählt, in der die Moral so eine Tat nicht verhindern kann.
(K) Und auch nicht erklären kann.
(S) Nicht erklären kann, und in der es auch keine Reue gibt oder keine Rache, sondern wo es einfach nur Müdigkeit gibt, Aufgabe, Aufgabe eines Lebens, das die öffentlichkeit mir nicht erlaubt zu leben. …
(K) Er tritt jetzt in die Spur seiner Taten, er erfüllt sein Leben. …
(S) Die Frage, woher diese Taten gekommen sind, bleibt (aber) ungelöst. Und diese ungelöste Frage bringt das Geschichtenerzählen hervor, … . Uns interessiert nur eine Tat, von der wir nicht wissen, wie sie zustande kommen konnte und deren Grausamkeit wir nicht fassen können. Das ist auch genau das, was im Fall Zurwehme eine Rolle gespielt hat. Wir versuchen, uns ein Bild zu machen, und wenn das nicht gelingt, erzählen wir. Dann erzählen wir immer wieder, so lange, bis wir das Gefühl haben zu verstehen, aber es funktioniert in diesem Fall eben nicht. …Wenn etwas mutmaßlich Böses unterwegs ist, dann ist das höchste Interesse zu verstehen, woraus es besteht.
(S) Ja, woraus besteht es, wie kann ich seiner habhaft werden?
(K) Ist es ein Stück von mir?
(S) Und könnte das Böse nicht auch der Wanderer sein? Das ist genau das, was uns dann auch Angst macht und was diese Empörung ganz zuletzt auch hervorgerufen hat, dass eben in jedem Touristen und in jedem Wanderer immer noch ein bisschen dieses Exterritoriale, dieses Unbehauste und Gefährdete anwesend ist.
(K) Das geordnete Haus ist sicher. Ich weiß, die Verbrecher sind im Moment abwesend, ich verteidige mich nach außen, wie im Märchen von den »Sieben Geißlein«. Und alles, was draußen ist, ist unheimlich. Das ist ein 400 oder 600 oder 900 Jahre altes Lebensgefühl in unserer Sprache.
(S) Ja, und das kommt jetzt in einem ganz neuen Gewand daher, indem es eine unglaubliche Faszination und auch ein Angstpotential gewinnt. Insofern ist der Tourismus im Grunde die reine Sesshaftigkeit. Der Tourist findet überall sein Zuhause, der Tourist kennt jedes Hotel, steigt in Ketten ab, wo er das Zimmer kennt, egal ob in Chicago, in San Francisco oder in Thailand, die Hotelzimmer sehen immer gleich aus. Hier stoßen zwei Diskurse zusammen: der Diskurs des fahrenden Verbrechers und der Diskurs des Touristen. Und daraus ergibt sich ein Moment der hohen Irritation.
(K) Und der hohen Einschaltquote.
… Auszug aus: News & stories, 21.5.2000 (Erstveröffentlichung als Printfassung in: Alexander Kluge – Facts and Fakes; Verbrechen 1; Fernseh-Nachschriften, Verlag Vorwerk 8, 2000, hg. von Christian Schulte, Reinald Gußmann)
WHAT IS THE PUTATIVE EVIL?
»The police described Dieter Zurwehme as ›highly dangerousü. He had escaped from Bielefeld prison, whilst taking his allowed walk. It was presumed that he had killed four persons whilst on the run. ...« This is how the »case ›Dieter Zurwehmeü starts. It was extremly present in the Press and Media and was strongly discussed. Even if you were not really interested in it you were bombarded by information about the case. The whole country lived in fear and Zurwehme was supposedly seen everywhere. Subsequently the search for the fugitive failed, not because of a lack of hints, but because there were far too many and each of everyone of them could have been right or wrong.«
This is also a story about hundreds of policemen combing corn fields and forrests to track down the murderer, about a collective fear of an omnipresent killer, about innocent victims and an unbelievably simple end.
Finally, he was caught by chance. Somebody recognized him while passing by in a car. The driver even turned round to check if the face matched the photofit picture given out by the police. Only then did he go to the next police station and said: »Please come with me.«
»Zurwehme answers, when asked by the officers for his papers: ›I don’t have a passport, but I am the one you are looking forü, …And this is a statement, where this putative murderer fundamentally surpasses himself. …›I am the one you are looking forü, … in these words an unbelievable detachment is expressed.†…It means: I am the one who is now identifying himself with the image that you have created.«
All these events are the background and the motivation for an exchange of ideas between Alexander Kluge (filmmaker, author) and the Romance philologist Dr. Ulrike Sprenger. The dialogue repeatedly comes back to the question: How do we recognize the Evil? Or, in the concret case: Is it me, the person Zurwehme, or is it someone else? Who is the murderer, that is wandering through the corn fields of this summer? »Is it possible that ›the hikerü himself is the Evil? In that case, this is exactly what is responsible for what is frighting us, what evokes the fear and shock, that every tourist and every hiker still carries the remains of ›the exterritorialü, ›the uninhabitedü and ›the endangeredü as well as the danger itself.«…
And finally: Who is telling the story of Zurwehme? – The Police? The real circumstances? The Media? It is only obvious, that it is since 300, 400 years, that these kinds of stories are told – and here as well: anonymous.